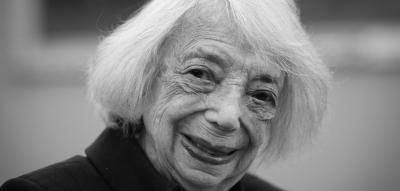Was passiert, wenn man Shakespeares „Richard III.“ in ein drastisch überzeichnetes Berlin der Gegenwart verlegt? In Burhan Qurbanis Film „Kein Tier. So Wild.“ liegen arabische Clans miteinander im blutigen Clinch. Die österreichische Schauspielerin Verena Altenberger, die auch in Salzburg schon die Buhlschaft war, spielt Elisabet York, eine Frau, zerrieben zwischen Loyalität und Rache, bis sie schließlich radikaler handelt als alle anderen. Am Rande des Berlinale-Trubels haben wir uns getroffen, für ein Gespräch über Theatralik im Kino, den österreichischen Hang zum Abgründigen und über Kontrollverlust, der zur Klarheit führt.
WELT: Die Geschichte von „Kein Tier. So Wild.“ ist sehr archaisch – sie geht auf Shakespeare zurück und bringt diese spezielle Wucht mit. Ist das etwas, das alte Stoffe auszeichnet, gerade im Vergleich zu dem, was sich normalerweise in einem modernen saturierten Milieu erzählen lässt?
Verena Altenberger: Ja, das Archaische ist spürbar, wenn man mit Shakespeare anfängt. Aber ich glaube, es liegt noch mehr an Burhan, dem Regisseur. Er traut sich, Gewaltigkeit zu erzählen. Ich liebe das österreichische Kino, weil wir – salopp gesagt – selten auf den Markt schielen müssen. Es ist uns oft wurscht. Wir sind zu wenige, als dass wir groß kalkulieren könnten. Daraus entsteht Mut. Und Burhan bringt genau das mit: keine Angst vor Opulenz, vor Überzeichnung, vor Kitsch oder Klischee. So hatten auch wir Schauspieler keine Angst, Theater zu spielen.
WELT: Das fällt auf – eine lustvoll inszenierte Theatralik. Viele Darsteller kommen vom Berliner Gorki-Theater. Wird diese Ästhetik nun filmisch übersetzt?
Altenberger: Ich glaube, entscheidend war: Wir hatten keine Angst vor dem „Zuviel“. Nicht davor, dass Leute das hassen könnten. Nicht vor Gewalt, nicht vor großen Bildern oder Gesten. Gleichzeitig haben wir aber im Ensemble – und damit meine ich Cast und Crew – immer nach dem Kern gesucht. Keine Geste war leer. Jede Szene, so groß sie auch war, hatte einen diskutierten, erarbeiteten Grund. Warum sprechen diese zwei Frauen so miteinander? Warum hassen sie sich – oder sind sie nicht vielleicht doch fast Freundinnen? Wir sind ganz tief gegangen.
WELT: Vielleicht hängt diese Tiefenbohrung auch damit zusammen, dass die Vorlage aus einer vorpsychologischen Zeit stammt. Shakespeare hat Figuren geschaffen, deren Handlungen man nicht restlos erklären kann. Diese Unergründlichkeit wirkt bis heute.
Altenberger: Ja. Ich habe den Film jetzt zum dritten Mal gesehen – und denke, dass ich meine Figur wirklich verstanden habe. Und trotzdem habe ich mich mit diesem Verstehen in einen Pool geworfen und treiben lassen. Ich wusste nicht immer, warum es mich wohin zieht. So erlebe ich den Film auch: Man hat Momente der Klarheit, dann wieder wird man fortgerissen, eine neue Welle kommt, man muss sich neu sortieren. Das ist schön – und beunruhigend.
WELT: Es gibt im Film eine Art Trennlinie zwischen den weißen Europäern und den Arabern. Die Rituale, die surreale Wucht – all das liegt vor allem auf arabischer Seite. Die Europäer wirken dagegen wie Träger psychologischer Milde. Ihre Figur will eigentlich nicht töten.
Altenberger: Und tut es dann doch.
WELT: Weil sie muss?
Altenberger: Weil der Zwang stärker ist als das Wollen. Sie könnte gehen – sie erfährt, dass ihre Kinder tot sind, sie könnte fliehen, das Geld nehmen. Aber sie bleibt. Und sie tötet. Am Ende handelt sie nicht anders als Rashida.
WELT: Rashidas Berserkerwut wiederum scheint nicht einmal notwendig. Sie stellt sich auch gegen die eigenen Leute. Es ist beinahe ein Akt des Wahnsinns.
Altenberger: Ja. Aber auch versteht man, woher die Wut kommt – und versteht zugleich nicht, wie sie so ausarten konnte.
WELT: Vielleicht rührt diese Wut aus der Weiblichkeit. Durch die Umkehrung: Richard III. ist jetzt Rashida. Es geht um Unterdrückung, um jahrhundertealte männliche Dominanz.
Altenberger: Es gibt da diesen etwas platten, aber treffenden Satz, den man manchmal am feministischen Kampftag auf Instagram sieht: „Männer sollten froh sein, dass wir nur Gleichberechtigung wollen – und nicht Rache.“ Wenn wir über weibliche Wut sprechen, dann ist der Film ein Ausbuchstabieren dieser Wut.
WELT: Er zeigt, wie Rache aussehen könnte.
Altenberger: Genau. Aber am Ende sagt Rashida in ihrem Monolog: „Ich bin nicht euer Gegenteil.“ Das ist entscheidend. Es ist eben kein Film über arabische Clanfamilien oder über migrantische Gewalt. Rashida ist nicht das „Andere“. Sie ist auch „wir“. Wenn am Ende in Frakturschrift „Heil Rashida“ steht, dann lese ich: „Heil Kickl“. Das ist nicht das Gegenteil – das ist Teil unserer Realität. Der Film handelt von Gewalt – nicht von deren Gewalt, sondern von unserer.
WELT: Sie haben vorhin von einer spezifisch österreichischen Kraft gesprochen. Ich frage mich oft, warum wir Deutschen – in einem viel größeren Land – nicht mehr solch gewaltige Schauspielertypen hervorbringen wie Nicholas Ofczarek, Josef Hader oder Sophie Rois. Vielleicht sind die Österreicher die Araber der Deutschen?
Altenberger: Den Satz unterschreibe ich dann wohl.
WELT: Woran mag das liegen?
Altenberger: Wenn ich über Österreich nachdenke, kommen mir Worte wie: Dreck. Abgrund. Und das passt. Dass die Psychoanalyse aus Wien kommt – logisch. Dazu das Jüdische, der Balkan, der Süden – Italien. Ein Melting Pot. Wir waren mal ein Weltreich. Das spukt noch herum.
WELT: Wien ist bis heute eine der schönsten Städte Europas. Eine Wucht. Und gleichzeitig so klein, so unbedeutend. Was macht das mit einer kollektiven Psyche?
Altenberger: Wir waren mal wer. Jetzt sind wir’s nicht mehr. Aber wir wären gern. Und ich glaube, wir haben unsere Geschichte nie wirklich aufgearbeitet. Österreich hat sich eine Zeit lang verhalten, als wäre es aus eigenem Antrieb oder aus Einsicht geschehen – dabei war es eher eine internationale Vereinbarung: Man spricht jetzt anders, man verhält sich anders. Jetzt, wo diese Vereinbarungen weltweit bröckeln, bricht etwas auf. Der Druck ist weg. Wir zeigen wieder unser wahres Gesicht. Und das ist sehr abgründig.
WELT: Deutschland hat viel aufgearbeitet – und doch sitzt der eigentliche Schmerz womöglich woanders. Wir sind ein zerrissenes Land: halb Westen, halb Osten, halb Rationalismus, halb Rausch.
Altenberger: Auch da bin ich wieder beim Film: Manches verstehe ich, manches begreife ich nur unbewusst. Ich versuche, Bilder zu finden. Wien zum Beispiel: eine Stadt von überirdischer Schönheit. Du steigst irgendwo aus der U-Bahn und stehst vor Pracht. Aber unter der Stadt? Das größte Katakomben-Netz Europas. Die Pest hat gewütet. Die Knochen stapeln sich. Unsere Herrscher liegen eingekocht in Rotwein unter der Erde. Das ist für mich Österreich: oben Glanz, unten Fäulnis. Und das eine geht nicht ohne das andere.
WELT: Vielleicht braucht es genau dieses Doppelte, um die Balance zu halten.
Altenberger: Vielleicht. Aber eigentlich könnten wir ja zufrieden sein. Unserem Land ginge es gut – mit ein bisschen mehr Arbeit, ein bisschen mehr Mut zur Veränderung, auch für das Klima, könnten wir zufrieden und friedlich leben. Aber was tun wir? Wir eskalieren an die Ränder. Es gibt eine Lust, die Zerstörung zu sehen. Irgendeine Lust in uns will sehen, wie dieses System, das uns am Leben hält, auseinanderfällt.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.