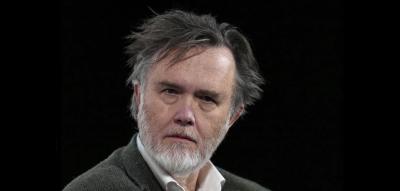Das Fernsehen ist nicht tot – es ist ein erfolgreiches Abo-Modell. Während das klassische Fernsehen Zuschauer verliert, boomt das Streaminggeschäft der Privatsender. RTL+ zählt mittlerweile 8,5 Millionen zahlende Nutzer – vor allem dank Formaten wie „Ex on the Beach“, „Temptation Island“ oder „Prominent getrennt“. Ähnliches gilt für Joyn, die Plattform von Pro7 und Sat.1. Was vor wenigen Jahren noch als Trash galt, ist heute etablierte Unterhaltung für ein Millionenpublikum.
Melody Haase kennt diese Welt. Seit ihrer Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ ist sie eine feste Größe im Reality-TV. Sie war Teilnehmerin bei „Couple Change“, „The Fifty“ und „Promis unter Palmen“. In diesem Gespräch analysiert sie den Erfolg von Reality-TV und wie sich Ruhm in den letzten 30 Jahren verändert hat. Sie spricht über den schmalen Grat zwischen Selbstbestimmung und Selbstauslieferung, über Intimität vor der Kamera – und die Frage, was der Erfolg dieser Formate über die Gesellschaft aussagt.
WELT: Frau Haase, woher kommt der Wunsch, berühmt zu sein?
Melody Haase: Menschen wollen heute berühmt sein, weil sie Angst haben, zu verschwinden. Aufmerksamkeit wird zur Ersatzreligion. Ich habe das in der Branche immer wieder erlebt: Manche gehen nicht ins Reality-TV, weil sie etwas erzählen wollen, sondern weil sie sonst niemand wahrnimmt.
WELT: Das Streben nach Ruhm im Reality-TV ist der Versuch, der eigenen Vergänglichkeit etwas entgegenzusetzen?
Haase: Es ist, als müsste man sich und seinen Mitmenschen ständig versichern, dass man noch da ist. Ich habe mal eine Serie gesehen – es ging um einen Serienmörder, der ursprünglich einfach nur Reality-Star werden wollte und bei jedem Casting abgelehnt wurde. Das klingt extrem, aber es zeigt, wie nah Geltungsdrang und Wahnsinn manchmal beieinanderliegen.
WELT: Gilt das nicht auch für Sie? Sie sind regelmäßig im Reality-TV zu sehen.
Haase: Ja, der Unterschied ist nur: Ich mache das nicht, um berühmt zu sein. Ruhm muss einem Zweck dienen. Ruhm um des Ruhms willen bringt nichts. Ich musste mir meinen Platz im Reality-TV erst suchen. Heute sehe ich meinen Mehrwert darin, meine Geschichte zu teilen – um anderen Hoffnung zu geben. Ich habe viel erlebt, viel überlebt. Wenn meine Geschichte jemandem hilft, einen Schritt aus der Dunkelheit zu gehen, dann war es das wert.
WELT: Vor über zehn Jahren startete Ihre TV-Karriere bei „Deutschland sucht den Superstar“. Was hat Sie damals bewogen, sich für die damals größte Casting-Show des Landes zu bewerben?
Haase: Ich habe als Kind immer vom Singen geträumt. Jeder, der mich singen hörte, meinte: „Du musst zu Dieter“. Als ich 19 war, hat es geklappt, ich stand plötzlich vor Dieter Bohlen – das war für mich riesig. Und ich bin bis in die Liveshows gekommen.
WELT: Wussten Sie damals, worauf Sie sich da einlassen?
Haase: Damals nicht. Heute weiß ich: So viel Aufmerksamkeit ist nicht gesund. Der Mensch ist ein empfindsames Wesen – geschaffen für Beziehung, nicht für ständige Betrachtung. Ich habe damals nicht erkannt, dass wir in dieser Scheinwelt des Fernsehens weniger Menschen als Mittel sind: Projektionsflächen für Werbeindustrie und Unterhaltung.
WELT: Hat sich Ruhm in den zehn Jahren ihrer Fernseh-Karriere verändert?
Haase: Total. Früher war Ruhm meist an Leistung gebunden. Heute reicht Sichtbarkeit. Likes ersetzen Anerkennung und Reality-TV ist das Schaufenster. Aber wer einmal in diesem Schaufenster steht, merkt schnell, dass es auch entmenschlichend sein kann. Wir sind nicht für so viel Dauerbeobachtung gemacht.
WELT: Sie haben gesagt, „DSDS“ sei für Sie trotzdem der richtige Weg gewesen. Warum?
Haase: Für mich war es der erste Schritt raus aus einer schwierigen Kindheit und einem ziemlich chaotischen Leben. Ich war teilweise obdachlos, auch während „DSDS“. Ich habe auf der Couch von Freunden geschlafen, manchmal auch im Bus. Einmal hat mich der Fahrer nachts geweckt und gesagt: „Endstation“. Ich hatte keinen Plan, wo ich hin sollte. Wenn du ganz unten warst, verändert sich dein Blick auf alles.
WELT: Wie sind Sie ins Reality-TV gekommen?
Haase: Nach „DSDS“ kamen die ersten Angebote – viele habe ich abgelehnt. Ich wollte seriös sein. Aber dann hatte ich Schulden, musste dringend Geld verdienen. Mein erstes großes Format war „Adam sucht Eva“ – ein Format, in dem man komplett nackt andere Leute vor laufender Kamera datet. Darüber spreche ich bis heute ungern. Ich habe das gemacht, obwohl es mir psychisch nicht gut ging. Ich hätte mit meinen Depressionen damals gar nicht vor der Kamera stehen dürfen.
WELT: Wie schafft man es, unter solchen Umständen nackt vor eine Kamera zu treten?
Haase: Das war wirklich schwer. Ich habe das einfach gemacht, weil ich dachte, ich muss. Ich hatte Schulden, ich war jung, ich war unsicher – und ich habe so getan, als wäre ich wie die anderen. Ich habe mich in eine Rolle gedrängt, von der ich dachte, dass sie von mir erwartet wird.
WELT: Sie sind dann einige Zeit von der Reality-Bildfläche verschwunden.
Haase: Es ging irgendwann einfach nicht mehr. Ich war psychisch am Ende. Die Depressionen haben sich durch mein Leben gezogen, aber in dieser Phase war es besonders schlimm. Ich war nicht belastbar, konnte mit dem Hass der Zuschauer nicht umgehen, nicht mit der Öffentlichkeit, nicht mit mir selbst. Ich habe getrunken, um mir vorzugaukeln, dass es mir gut geht. Ich war nicht reflektiert, ich war nur überfordert.
WELT: Wer hat Sie da herausgeholt?
Haase: Meine Mutter. Sie hat mir damals eine kleine Wohnung angemietet. Da war nichts drin außer einer Matratze und ein Fernseher mit eingebautem DVD-Player. Ich habe gefühlt hundertmal mal „Fight Club“ geguckt, mit Audiokommentar, auf Englisch, auf Deutsch. Mag klischeemäßig klingen, aber das war der Beginn meiner Heilung. Ich habe bei Hilf-Hotlines angerufen, war in Therapie und habe versucht, Ordnung in mein Leben zu bringen.
WELT: Und trotzdem sind Sie zurück vor die Kamera und in die chaotische TV-Welt.
Haase: Irgendwann ging es mir besser. Mein erstes Format danach war „Couple Challenge“, was mir großen Spaß gemacht hat. Es geht darum, zusammen mit einem Partner in Spielen über sich hinauszuwachsen. Zu der Zeit kam dann auch OnlyFans dazu. Dafür gab es einen konkreten Auslöser: Jemand drohte, Nacktbilder von mir zu veröffentlichen. Ich dachte: Dann mach’ ich es lieber selbst. Ich wollte die Kontrolle zurück.
WELT: War das für Sie eine Form der Selbstbestimmung?
Haase: Anfangs ja. Ich hatte das Gefühl, jetzt bestimme ich. Ich entscheide, was von mir sichtbar wird. Das kam mir vor wie ein feministischer Akt. Im Nachhinein weiß ich, das habe ich verklärt.
WELT: Ist Geld mit den eigenen Nacktbildern zu verdienen nicht selbstbestimmt?
Haase: Das muss jede für sich selbst entscheiden. Bei mir gab es aber einen Moment, der alles änderte: Micaela Schäfer hat mich zu einer Kooperation für OnlyFans eingeladen. Ich kam ins Studio – professionelles Licht, Kameramann, perfektes Setting. Ich stand in High Heels auf einem kalten Studioboden und dachte nur: Das hier hat nichts mehr mit mir zu tun. Ich sah mich selbst – nicht stark, nicht frei, sondern entfremdet. Ich habe einen Schlussstrich gezogen, mich bei Micaela entschuldigt. Diese Erfahrung hat mir gezeigt: Selbstbestimmung ist auch, nein zu sagen – selbst wenn es vorher ein Ja war.
WELT: Sie zeigen im TV trotzdem viel: Emotionen, aber auch ihren Körper und Intimitäten. Wo ziehen Sie die Grenze?
Haase: Ich zeige gern Haut. Ich mag es, mich zurechtzumachen, Frau zu sein. Aber ich flirte oft mehr, als es ernst gemeint ist. In meinem Privatleben würden mich manche sogar als prüde bezeichnen. Intimität heißt für mich nicht, alles preiszugeben. Es geht ums Gefühl der Kontrolle. Ich zeige mich – aber zu meinen Bedingungen.
WELT: Gibt es etwas, das nur Ihnen gehört und Sie bewusst nicht teilen?
Haase: Ja, aber ich verrate nicht, was. Sonst würde ich es ja teilen.
WELT: Lassen Sie uns über den Erfolg von Reality-TV als gesellschaftliches Phänomen sprechen. Warum, glauben Sie, schauen so viele Menschen Reality-TV?
Haase: Weil es etwas Archaisches bedient. Evolutionsbiologisch war es für uns überlebenswichtig zu wissen, wer mit wem verbunden ist, wer Streit hat, wer gefährlich ist. Klatsch und Tratsch sind uralte soziale Werkzeuge.
WELT: Trotzdem ist nicht alles „real“, was im Reality-TV passiert. Vieles wird inszeniert.
Haase: Ich sehe Reality-TV wie ein Lagerfeuer: Wir im Publikum beobachten andere, um uns selbst zu verorten. Wir urteilen, vergleichen, lernen – oder schalten ab, weil uns das eigene Leben zu schwer ist. Vielleicht ist Reality-TV deshalb so erfolgreich, weil es ein Fenster ist, durch das wir sowohl nach draußen als auch nach innen schauen können.
WELT: Haben Sie manchmal Angst, irgendwann nicht mehr relevant zu sein?
Melody: Nein. Viele definieren sich so stark über Sichtbarkeit, dass die Pause zwischen zwei Formaten zur Bedrohung wird. Ich sehe das anders. Ich bin in einer guten Phase, arbeite viel und habe Ziele außerhalb vom Reality-TV. Für mich ist auch Social Media kein Lebensinhalt. Ich verdiene dort kein Geld, sehr zum Leidwesen meines Steuerberaters.
WELT: Sie sagen, Sie wollen Menschen Hoffnung machen. Was meinen Sie damit?
Haase: Ich bekomme nach Formaten oft Nachrichten von Menschen, die sagen, sie hätten sich nach meiner Geschichte erstmals Hilfe gesucht. Manche sind deswegen in Therapie gegangen. Das berührt mich sehr. Ich habe auch nie geglaubt, dass mein Leben mal so schön wird, wie es heute ist. Und wenn ich das geschafft habe, dann ist es für andere auch möglich.
WELT: Würden Sie sagen, dass es auch so etwas wie eine Aufwärtsspirale gibt?
Haase: Interessant ist doch: Es gibt ein Wort für den Teufelskreis, aber keines für sein Gegenteil. Vielleicht liegt das daran, dass unsere Sprache das Negative präziser benennen kann als das, was sich langsam verbessert. Ich habe gemerkt: Wenn man kleine Dinge ändert, kommt Bewegung rein. Man trifft bessere Entscheidungen, fühlt sich sicherer. Und irgendwann merkt man: Man ist da, wo man nie gedacht hätte, je wieder hinzukommen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.