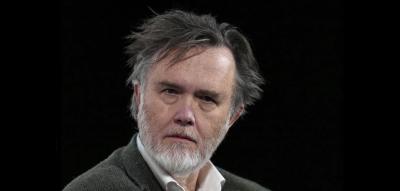In der Liste all jener Filme, die bei Menschen Albträume und Ängste hervorrufen, liegt ausgerechnet einer ziemlich weit oben, den man eher ganz oben auf der Kitschliste vermutet hätte: „Bambi“, die Geschichte vom jungen Weißwedelhirsch und seinen kleinen Tierfreunden im amerikanischen Gehölz. Kam 1942 in die Kinos, basiert auf „Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde“, dem 1923 erschienen und von den Nazis 1936 verbotenen Reh-Roman des österreichischen Juden Felix Salten, einem Klassiker des Nature Writings und einer Hymne auf die Freundschaft, den Wald und den Kreislauf des Lebens. Eigentlich.
Zum Fest für alle Therapeuten wurde Disneys Filmfabel aber nicht etwa wegen der Enttäuschung von Vierjährigen, dass Tiere gar nicht reden können, sondern durch den Tod der Mutter des kulleräugigen Hirschkalbs. Sie opfert sich für ihr Kind, wirft sich statt seiner in die Kugel des Jägers, im Kino weinen Kinderaugen Taschentücher voll, das Trauma beginnt.
Zur Beruhigung aller Eltern mit Kindern im Vorschulalter und zum Ärger aller Traumatologen sind Spätfolgen wie die von Disneys „Bambi“ nach Michel Fesslers Neuverfilmung des Saltenschen Naturhymnus mit echten Tieren eher nicht zu erwarten. Man hört einen Schuss, den Tod der Hirschkuh sieht man genauso wenig wie man in den 80 Minuten überhaupt auch nur eines Menschen ansichtig wird. Die Taschentücher bleiben trocken. Niemand muss getröstet werden. Fessler, als filmischer Naturdramatiker vor zwanzig Jahren bekannt geworden mit „Die Reise der Pinguine“, will auch mit „Bambi“ vor allem dem „Tier seinen Platz im natürlichen Staunen über den Wald zurückgeben“.
Der Realfilm-„Bambi“ des Franzosen – eine Mischung aus Naturdokumentation und Kinderspielfilm – umgeht zwar naturgemäß sämtliche Debatten über eventuell woke und farbenblinde Querbesetzungen, wie es sie nach den jüngsten Realfilmversionen von Disney-Klassikern wie „Arielle“ und „Schneewittchen“ gab. Allerdings ist auch bei Fessler Saltens Reh ein Hirsch. Das liegt womöglich an der prinzipiellen Undressierbarkeit von Rehen.
Und könnte Waldökologen beruhigen, für die „Bambi“, so der bayerische Reh-Bestsellerautor Rudolf Neumaier, als Bettkantenlesung ein Supergau ist, weil es am Ende der Lektüre des Buches, das alles andere als ein Kinderbuch ist, schwerfällt, Rehe als Schädlinge des Waldes hinzustellen und ihren Abschuss zu rechtfertigen. Wenigstens ist der Waschbär, den man sieht, wirklich ein Waschbär und der Wolf ein Wolf. Bambis Freund Hase allerdings ist – gewissermaßen farbenblind – wie bei Disney mit einem zugegeben sehr süßen Kaninchen besetzt. Immerhin heißt er nicht Klopfer.
Ärger eingehandelt hat sich Fessler trotzdem. Weil er für die Dreharbeiten im Wald bei Orlèans eigens ein Trainingscamp für seine Tiere eingerichtet und spezielle Tiertrainer beschäftigt hatte. Was wiederum Naturschützern in Frankreich nicht wirklich gefallen hat, auch wenn bei „Bambi“ kein Tier zu Schaden kam. Fesslers „Bambi“ ist eine Legende, ein mildes Märchen, eine sanft bedrohte Idylle im Kreislauf der Jahreszeiten und des Tierlebens, die nichts wissen will von Waldschadensberichten, Klimakatastrophen.
Ein kräftiger Windhauch der Fünfziger weht durch Fesslers Forst, was unter anderem daran liegt, dass die Tiere zwar zum Glück nicht selbst reden, aber ständig aus dem Off angerufen, gewarnt werden vor Gefahren, weil aus dem Off erzählt wird, was Bambi denkt, was seine Freunde denken. Da, also im Off, sitzt Senta Berger und spricht Texte, die klingen, als seien sie nicht den beiden „Bambi“-Bänden von Felix Salten, des Jung-Wieners, Schnitzler Kumpels und Lieblingsfreundfeinds von Karl Kraus (legendär: Salten ohrfeigte Kraus 1897), entnommen, sondern apokryphen Manuskripten von Bernhard Grzimeks „Ein Platz für Tiere“.
Salten, als Siegmund Salzmann 1869 in Pest geboren, in Wien zu einem ziemlich zentralen Kaffeehausliteraten aufgestiegen, selbst Jäger mit einem Revier vor Wien, Autor auch von „Fünfzehn Hasen“ und der „Jugend des Eichhörnchens Perri“, hat zwar als Rechtfertigung für die Anthromorphisierung seines tierischen Personals mal gesagt, „suche immer das Tier zu vermenschlichen, so hinderst du den Menschen zu vertieren“ (ein Programm, das in Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht sehr erfolgreich war; Salten musste vor den Nazis fliehen und starb mehr oder weniger mittellos 1945 in Zürich).
Die lebenslange Liebe eines Hirschen
Darin, es mit der Vermenschlichung zu übertreiben, steht Fessler Disney genauso wenig nach wie in der Vermeidung irgendwelcher Menschenverteufelung. Jeder Verhaltensforscher jedenfalls verlässt das Kino mit gesträubten Haaren und geröteten Händen, mit denen er seinen Kindern vorher die Ohren zugehalten hatte. Damit sie nicht glauben, was sie da hätten hören können.
Die Geschichte vom Hirschkalb zum Beispiel, das sich auf den ersten Blick und für sein ganzes restliches Leben in seine Cousine Faline verliebt. Oder die Geschichte vom König des Waldes, der gottgleich wacht über Bambi, seinen Sohn, an dem er sein Wohlgefallen hat und an den er erst sein Wissen, dann seine Macht abgibt. Das ganze Gerede vom Gerede der Tiere untereinander, von der Freundschaft von Waschbär und Hirsch.
Saltenianer sollten sowieso auch diesmal wieder Abstand nehmen vom Kinogang. Weil von der schillernden Mehrdeutigkeit des Romans nicht mehr übrig ist als das schier Waldwebenmärchenhafte. Die Spiegelung des Ersten Weltkriegs, des Antisemitismus in der Jägerfigur, die Metaphernhaftigkeit für die Kleinbürgerexistenz des Rehseins, die sexuelle Aufgeladenheit des Textes, dessen Autor zumindest nie dementiert hat, dass er auch verantwortlich ist für „Josefine Mutzenbacher“ (Untertitel: „Die Geschichte einer Wiener Hure“).
Immerhin wird man hinterher noch träumen dürfen. Dass es im Wald und nicht nur dem von Orlèans tatsächlich so wunderbar und schwebend und lichtdurchflutet farbenfroh aussieht wie das, was Patrick Wack mit der Kamera eingefangen hat. Dass – zumindest im Wald von Orlèans – noch nicht alles zu spät ist. Dass da Myriaden von Schmetterlingen über Lichtungen im Forst fliegen. Dass es friedlich und still ist in der Nacht im Unterholz. Dass Freundschaft unter Tieren möglich ist, wie es sie unter den Menschen nicht gibt. Da kränkelt kein Bild.
„Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde“ erspart den Besuch im Streichelzoo, der wiederum natürlich der Gipfel der Verlogenheit ist. Wer am Ende gleich in den Wald will, sei gewarnt: Hirsche sind in deutschen Mittelgebirgen eher selten. Rehe sehen sehr anders aus als Bambi (wer wissen will, wie: Sie stehen auf den Wiesen entlang der Autobahn). Sehr scheu sind beide. Wildschweine riecht man tagsüber besser, als man sie sieht. Der Waschbär ist des Kaninchens Feind. Schmetterlinge sterben aus. Glühwürmchen tanzen immer weniger. Und in der Nacht ist es zwischen Tanne und Eiche nicht friedlich und nicht still.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt beim ursprünglichen Autor. Die erneute Veröffentlichung dieses Artikels dient ausschließlich der Informationsverbreitung und stellt keine Anlageberatung dar. Bei Verstößen kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Wir werden bei Bedarf Korrekturen oder Löschungen vornehmen. Vielen Dank.